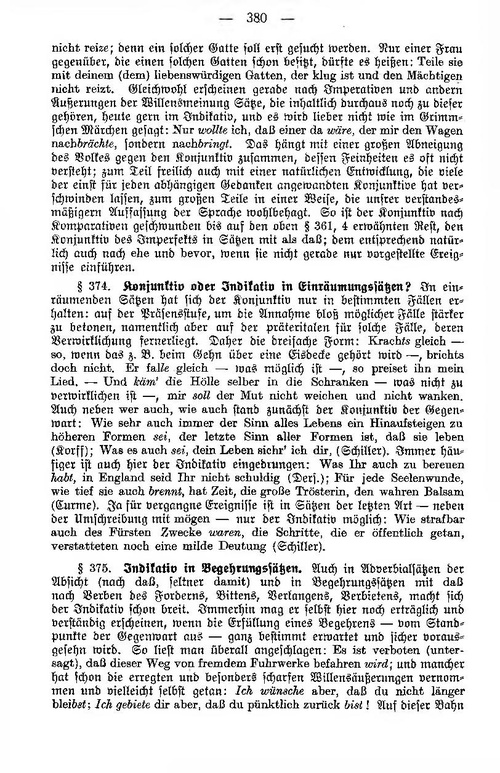Konjunktiv oder Indikativ in Einräumungssätzen
Hinweis: Dieses Kapitel ist derzeit noch in Bearbeitung. Die angezeigten Informationen könnten daher fehlerhaft oder unvollständig sein.
| Buch | Matthias (1929): Sprachleben und Sprachschäden. Ein Führer durch die Schwankungen und Schwierigkeiten des deutschen Sprachgebrauchs. |
|---|---|
| Seitenzahlen | 380 - 380 |
Nur für eingeloggte User:
| Unsicherheit |
|---|
In diesem Kapitel behandelte Zweifelsfälle
| Text |
|---|
|
In einräumenden Sätzen hat sich der Konjunktiv nur in bestimmten Fällen erhalten: auf der Präsensstufe, um die Annahme bloß möglicher Fälle stärker zu betonen, namentlich aber auf der präteritalen für solche Fälle, deren Verwirklichung fernerliegt. Daher die dreifache Form: Krachts gleich — so, wenn das z. B. beim Gehn über eine Eisdecke gehört wird —, brichts doch nicht. Er falle gleich — was möglich ist —, so preiset ihn mein Lied. — Und käm' die Hölle selber in die Schranken — was nicht zu verwirklichen ist —, mir soll der Mut nicht weichen und nicht wanken. Auch neben wer auch, wie auch stand zunächst der Konjunktiv der Gegenwart: Wie sehr auch immer der Sinn alles Lebens ein Hinaufsteigen zu höheren Formen sei, der letzte Sinn aller Formen ist, daß sie leben (Korff); Was es auch sei, dein Leben sichr' ich dir, (Schiller), immer häufiger ist auch hier der Indikativ eingedrungen: Was Ihr auch zu bereuen habt, in England seid Ihr nicht schuldig (Ders.); Für jede Seelenwunde, wie tief sie auch brennt, hat Zeit, die große Trösterin, den wahren Balsam (Curme). Ja für vergangne Ereignisse ist in Sätzen der letzten Art — neben der Umschreibung mit mögen — nur der Indikativ möglich: Wie strafbar auch des Fürsten Zwecke waren, die Schritte, die er öffentlich getan, verstatteten noch eine milde Deutung (Schiller). |
| Zweifelsfall | |
|---|---|
| Beispiel | |
| Bezugsinstanz | Korff - Hermann August, Schiller - Friedrich |
| Bewertung | |
| Intertextueller Bezug |