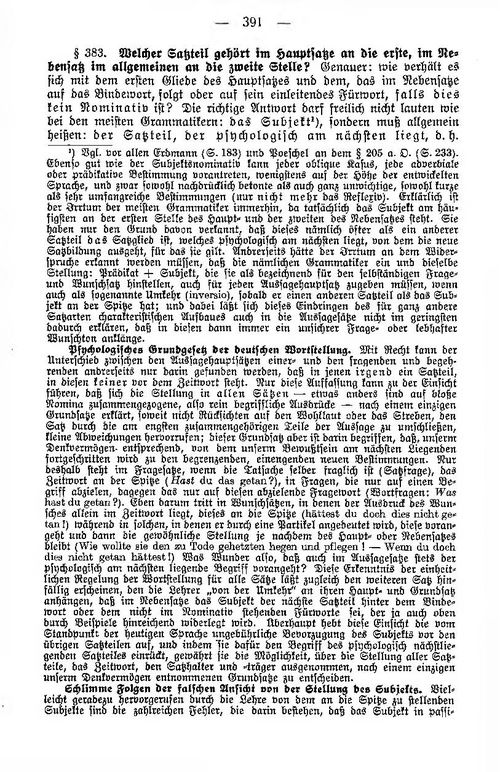Matthias(1929) Welcher Satzteil gehört im Hauptsatze an die erste im Nebensatz im allgemeinen an die zweite Stelle: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
|LetzteSeite=393 | |LetzteSeite=393 | ||
|KapitelNummer=4830 | |KapitelNummer=4830 | ||
|WorkflowStatus=gegengeprüft | |||
|WorkflowStatus= | |||
|KapitelText=Genauer: wie verhält es sich mit dem ersten Gliede des Hauptsatzes und dem, das im Nebensatze auf das Bindewort, folgt oder auf sein einleitendes Fürwort, falls dies kein Nominativ ist? Die richtige Antwort darf freilich nicht lauten wie bei den meisten Grammatikern: das Subjekt//1 Vgl. vor allen Erdmann (S. 183) und Poeschel an dem § 205 a. O. (S. 233). Ebenso gut wie der Subjektsnominativ kann jeher oblique Kasus, jede adverbiale oder prädikative Bestimmung vorantreten, wenigstens auf der Höhe der entwickelten Sprache, und zwar sowohl nachdrücklich betonte als auch ganz unwichtige, sowohl kurze als sehr umfangreiche Bestimmungen (nur nicht mehr das Reflexiv). Erklärlich ist der Irrtum der meisten Grammatiker immerhin, da tatsächlich das Subjekt am häufigsten an der ersten Stelle des Haupt- und der zweiten des Nebensatzes steht. Sie haben nur den Grund davon verkannt, daß dieses nämlich öfter als ein anderer Satzteil das Satzglied ist, welches psychologisch am nächsten liegt, von dem die neue Satzbildung ausgeht, für das sie gilt. Andrerseits hätte der Irrtum an dem Widerspruche erkannt werden müssen, daß die nämlichen Grammatiker ein und dieselbe Stellung: Prädikat + Subjekt, die sie als bezeichnend für den selbständigen Frage- und Wunschsatz hinstellen, auch für jeden Aussagehauptsatz zugeben müssen, wenn auch als sogenannte Umkehr (inversio), sobald er einen anderen Satzteil als das Subjekt an der Spitze hat; und dabei läßt sich dieses Eindringen des für ganz andere Satzarten charakteristischen Aufbaues auch in die Aussagesätze nicht im geringsten dadurch erklären, daß in diesen dann immer ein unsichrer Frage- oder lebhafter Wunschton anklänge.//, sondern muß allgemein heißen: der Satzteil, der psychologisch am nächsten liegt, d.h. $Seite 392$ der nach dem Zusammenhange der Sätze und dem Fortschritte der Darstellung vom Gegebenen, Vorausgehenden oder doch Vorausgesetzten der ist, welcher in unserm Bewußtsein oben aufliegt, weil wir die nächste Aussage als von ihm oder für ihn geltend erwarten. | |KapitelText=Genauer: wie verhält es sich mit dem ersten Gliede des Hauptsatzes und dem, das im Nebensatze auf das Bindewort, folgt oder auf sein einleitendes Fürwort, falls dies kein Nominativ ist? Die richtige Antwort darf freilich nicht lauten wie bei den meisten Grammatikern: das Subjekt//1 Vgl. vor allen Erdmann (S. 183) und Poeschel an dem § 205 a. O. (S. 233). Ebenso gut wie der Subjektsnominativ kann jeher oblique Kasus, jede adverbiale oder prädikative Bestimmung vorantreten, wenigstens auf der Höhe der entwickelten Sprache, und zwar sowohl nachdrücklich betonte als auch ganz unwichtige, sowohl kurze als sehr umfangreiche Bestimmungen (nur nicht mehr das Reflexiv). Erklärlich ist der Irrtum der meisten Grammatiker immerhin, da tatsächlich das Subjekt am häufigsten an der ersten Stelle des Haupt- und der zweiten des Nebensatzes steht. Sie haben nur den Grund davon verkannt, daß dieses nämlich öfter als ein anderer Satzteil das Satzglied ist, welches psychologisch am nächsten liegt, von dem die neue Satzbildung ausgeht, für das sie gilt. Andrerseits hätte der Irrtum an dem Widerspruche erkannt werden müssen, daß die nämlichen Grammatiker ein und dieselbe Stellung: Prädikat + Subjekt, die sie als bezeichnend für den selbständigen Frage- und Wunschsatz hinstellen, auch für jeden Aussagehauptsatz zugeben müssen, wenn auch als sogenannte Umkehr (inversio), sobald er einen anderen Satzteil als das Subjekt an der Spitze hat; und dabei läßt sich dieses Eindringen des für ganz andere Satzarten charakteristischen Aufbaues auch in die Aussagesätze nicht im geringsten dadurch erklären, daß in diesen dann immer ein unsichrer Frage- oder lebhafter Wunschton anklänge.//, sondern muß allgemein heißen: der Satzteil, der psychologisch am nächsten liegt, d.h. $Seite 392$ der nach dem Zusammenhange der Sätze und dem Fortschritte der Darstellung vom Gegebenen, Vorausgehenden oder doch Vorausgesetzten der ist, welcher in unserm Bewußtsein oben aufliegt, weil wir die nächste Aussage als von ihm oder für ihn geltend erwarten. | ||
| Zeile 15: | Zeile 14: | ||
}} | }} | ||
{{ThemaSubobjekt | {{ThemaSubobjekt | ||
|Zweifelsfall= | |Zweifelsfall=Syntaktische Möglichkeiten der Hervorhebung | ||
|Bezugsinstanz=Goethe - Johann Wolfgang, Sprachgelehrsamkeit | |Bezugsinstanz=Goethe - Johann Wolfgang, Sprachgelehrsamkeit | ||
}} | }} | ||
Aktuelle Version vom 2. Januar 2018, 10:49 Uhr
| Buch | Matthias (1929): Sprachleben und Sprachschäden. Ein Führer durch die Schwankungen und Schwierigkeiten des deutschen Sprachgebrauchs. |
|---|---|
| Seitenzahlen | 391 - 393 |
Nur für eingeloggte User:
| Unsicherheit |
|---|
In diesem Kapitel behandelte Zweifelsfälle
| Behandelter Zweifelfall: | |
|---|---|
| Genannte Bezugsinstanzen: | Sprachgelehrsamkeit, Goethe - Johann Wolfgang |
| Text |
|---|
|
Genauer: wie verhält es sich mit dem ersten Gliede des Hauptsatzes und dem, das im Nebensatze auf das Bindewort, folgt oder auf sein einleitendes Fürwort, falls dies kein Nominativ ist? Die richtige Antwort darf freilich nicht lauten wie bei den meisten Grammatikern: das Subjekt//1 Vgl. vor allen Erdmann (S. 183) und Poeschel an dem § 205 a. O. (S. 233). Ebenso gut wie der Subjektsnominativ kann jeher oblique Kasus, jede adverbiale oder prädikative Bestimmung vorantreten, wenigstens auf der Höhe der entwickelten Sprache, und zwar sowohl nachdrücklich betonte als auch ganz unwichtige, sowohl kurze als sehr umfangreiche Bestimmungen (nur nicht mehr das Reflexiv). Erklärlich ist der Irrtum der meisten Grammatiker immerhin, da tatsächlich das Subjekt am häufigsten an der ersten Stelle des Haupt- und der zweiten des Nebensatzes steht. Sie haben nur den Grund davon verkannt, daß dieses nämlich öfter als ein anderer Satzteil das Satzglied ist, welches psychologisch am nächsten liegt, von dem die neue Satzbildung ausgeht, für das sie gilt. Andrerseits hätte der Irrtum an dem Widerspruche erkannt werden müssen, daß die nämlichen Grammatiker ein und dieselbe Stellung: Prädikat + Subjekt, die sie als bezeichnend für den selbständigen Frage- und Wunschsatz hinstellen, auch für jeden Aussagehauptsatz zugeben müssen, wenn auch als sogenannte Umkehr (inversio), sobald er einen anderen Satzteil als das Subjekt an der Spitze hat; und dabei läßt sich dieses Eindringen des für ganz andere Satzarten charakteristischen Aufbaues auch in die Aussagesätze nicht im geringsten dadurch erklären, daß in diesen dann immer ein unsichrer Frage- oder lebhafter Wunschton anklänge.//, sondern muß allgemein heißen: der Satzteil, der psychologisch am nächsten liegt, d.h. $Seite 392$ der nach dem Zusammenhange der Sätze und dem Fortschritte der Darstellung vom Gegebenen, Vorausgehenden oder doch Vorausgesetzten der ist, welcher in unserm Bewußtsein oben aufliegt, weil wir die nächste Aussage als von ihm oder für ihn geltend erwarten. Was das bedeutet, mögen einige Mustersätze zeigen. Einen Abend — das gibt den zeitlichen Rahmen für das ganze Folgende an, ohne betont zu sein — stritt die Gesellschaft, ob der Roman oder das Drama den Vorzug verdiene .... Endlich war folgendes ohngefähr das Resultat ihrer Unterhaltung. Im Roman wie im Drama — diese Gegenstände der Unterhaltung sind bekannt, nicht aber betont — sehen wir menschliche Natur und Handlung .... Im Roman (gegeben und betont) sollen vorzüglich Gesinnungen und Begebenheiten vorgestellt werden, im Drama Charakter und Taten. Der Romanheld muß leidend ... sein, von dem dramatischen verlangt man Wirkung und Tat. So vereinigte man sich auch darüber usw. (Goethe). — Ich war nun einmal in einen Kreis hineingesperrt. Gewisse Verbindungen (eine Ausführung jenes Kreises) konnte ich nicht so los werden, und in der mir so angelegenen Sache — ist schon genannt — drängten und häuften sich die Fatalitäten. Auch im Nebensatze ist es durchaus die Regel, daß der Satzteil, der psychologisch näher liegt als das Subjekt, unmittelbar auf die Einleitung folgt, so namentlich oblique Fälle von Fürwörtern, die sich ja schon durch ihre Beziehung als dieser näher liegende Satzteil darstellen. Man ver- $Seite 393$ gleiche wieder Goethe: Sie setzte ihre Freigebigkeit gegen die Armen auf dem Heimwege fort, indem sie zuletzt, als ihr und ihren Reisegefährten (sind schon genannt) das Geld ausging (das stellte sich erst heraus), einem Mädchen ihren Strohhut ... hinauswarf. — Nun sollte Leseprobe gehalten werden, Wilhelm hatte die Rollen vorher kollationiert, so daß von dieser Seite (was das schon erwähnte kollationieren anlangt) kein Anstoß sein konnte ... Serlo versicherte, daß er jeder andern Probe ... nachsehn wolle, sobald der Leseprobe (schon vorher gegeben) ihr Recht widerfahren seiv. Dazu zwei etwas anders geartete Beispiele: Er erlaubte durchaus keine Freiheit, als die allenfalls die ganze Welt hätte wissen dürfen. — Da nun auch unglücklicherweise Regentage einfielen ..., so dankte er dem Himmel, als er sich dem flachen Lande wieder näherte. Man stelle nur um: die die Welt allenfalls hätte wissen dürfen, und: als Regentage unglücklicherweise einfielen, so ist jeder versucht zu fragen: „allenfalls wissen, aber nicht ahnen?" „Konnten die Regentage auch glücklicherweise einfallen?" Die Nachstellung würde zu einem Urteile nur über die Art des Kennenlernens und Einfallens führen, während die Voranstellung dieser Adverbien für die ganze Aussage, das Subjekt eingeschlossen, die richtige Auffassung gebietet. Daher kommt es ebensowohl, daß solche urteilende Adverbien (§ 45), als auch, daß Orts- und Zeitbestimmungen, die den Rahmen für das Ganze abgeben, gern vorangehn, letztere namentlich in Hauptsätzen. |
| Zweifelsfall | |
|---|---|
| Beispiel | |
| Bezugsinstanz | Goethe - Johann Wolfgang, Sprachgelehrsamkeit |
| Bewertung | |
| Intertextueller Bezug |