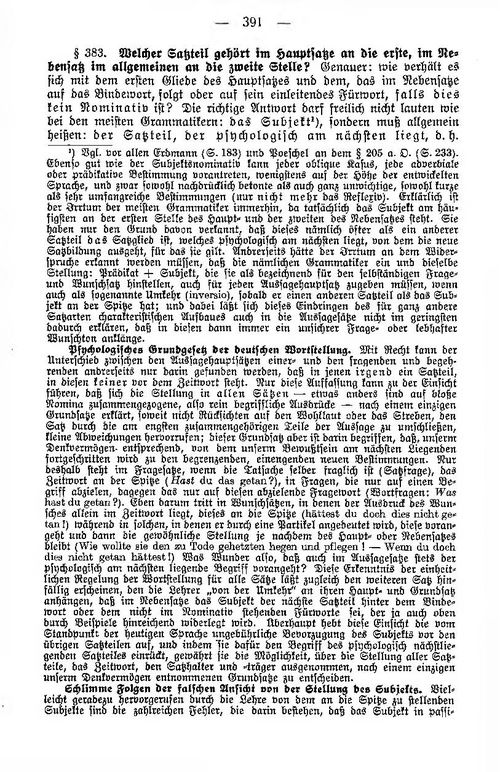Matthias(1929) Welcher Satzteil gehört im Hauptsatze an die erste im Nebensatz im allgemeinen an die zweite Stelle: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
|WorkflowStatus=überarbeitet | |WorkflowStatus=überarbeitet | ||
|KapitelText=Genauer: wie verhält es sich mit dem ersten Gliede des Hauptsatzes und dem, das im Nebensatze auf das Bindewort, folgt oder auf sein einleitendes Fürwort, falls dies kein Nominativ ist? Die richtige Antwort darf freilich nicht lauten wie bei den meisten Grammatikern: das Subjekt//1 Vgl. vor allen Erdmann (S. 183) und Poeschel an dem § 205 a. O. (S. 233). Ebenso gut wie der Subjektsnominativ kann jeher oblique Kasus, jede adverbiale oder prädikative Bestimmung vorantreten, wenigstens auf der Höhe der entwickelten Sprache, und zwar sowohl nachdrücklich betonte als auch ganz unwichtige, sowohl kurze als sehr umfangreiche Bestimmungen (nur nicht mehr das Reflexiv). Erklärlich ist der Irrtum der meisten Grammatiker immerhin, da tatsächlich das Subjekt am häufigsten an der ersten Stelle des Haupt- und der zweiten des Nebensatzes steht. Sie haben nur den Grund davon verkannt, daß dieses nämlich öfter als ein anderer Satzteil das Satzglied ist, welches psychologisch am nächsten liegt, von dem die neue Satzbildung ausgeht, für das sie gilt. Andrerseits hätte der Irrtum an dem Widerspruche erkannt werden müssen, daß die nämlichen Grammatiker ein und dieselbe Stellung: Prädikat + Subjekt, die sie als bezeichnend für den selbständigen Frage- und Wunschsatz hinstellen, auch für jeden Aussagehauptsatz zugeben müssen, wenn auch als sogenannte Umkehr (inversio), sobald er einen anderen Satzteil als das Subjekt an der Spitze hat; und dabei läßt sich dieses Eindringen des für ganz andere Satzarten charakteristischen Aufbaues auch in die Aussagesätze nicht im geringsten dadurch erklären, daß in diesen dann immer ein unsichrer Frage- oder lebhafter Wunschton anklänge. | |KapitelText=Genauer: wie verhält es sich mit dem ersten Gliede des Hauptsatzes und dem, das im Nebensatze auf das Bindewort, folgt oder auf sein einleitendes Fürwort, falls dies kein Nominativ ist? Die richtige Antwort darf freilich nicht lauten wie bei den meisten Grammatikern: das Subjekt//1 Vgl. vor allen Erdmann (S. 183) und Poeschel an dem § 205 a. O. (S. 233). Ebenso gut wie der Subjektsnominativ kann jeher oblique Kasus, jede adverbiale oder prädikative Bestimmung vorantreten, wenigstens auf der Höhe der entwickelten Sprache, und zwar sowohl nachdrücklich betonte als auch ganz unwichtige, sowohl kurze als sehr umfangreiche Bestimmungen (nur nicht mehr das Reflexiv). Erklärlich ist der Irrtum der meisten Grammatiker immerhin, da tatsächlich das Subjekt am häufigsten an der ersten Stelle des Haupt- und der zweiten des Nebensatzes steht. Sie haben nur den Grund davon verkannt, daß dieses nämlich öfter als ein anderer Satzteil das Satzglied ist, welches psychologisch am nächsten liegt, von dem die neue Satzbildung ausgeht, für das sie gilt. Andrerseits hätte der Irrtum an dem Widerspruche erkannt werden müssen, daß die nämlichen Grammatiker ein und dieselbe Stellung: Prädikat + Subjekt, die sie als bezeichnend für den selbständigen Frage- und Wunschsatz hinstellen, auch für jeden Aussagehauptsatz zugeben müssen, wenn auch als sogenannte Umkehr (inversio), sobald er einen anderen Satzteil als das Subjekt an der Spitze hat; und dabei läßt sich dieses Eindringen des für ganz andere Satzarten charakteristischen Aufbaues auch in die Aussagesätze nicht im geringsten dadurch erklären, daß in diesen dann immer ein unsichrer Frage- oder lebhafter Wunschton anklänge. | ||
Psychologisches Grundgesetz der deutschen Wortstellung. Mit Recht kann der Unterschied zwischen den Aussagehauptsätzen einer- und den fragenden und begehrenden andrerseits nur darin gefunden werden, daß in jenen irgend ein Satzteil, in diesen keiner vor dem Zeitwort steht. Nur diese Auffassung kann zu der Einsicht führen, daß sich die Stellung in allen Sätzen — etwas anders sind auf bloße Nomina zusammengezogene, also rein begriffliche Ausdrücke — nach einem einzigen Grundsatze erklärt, soweit nicht Rücksichten auf den Wohllaut oder das Streben, den Satz durch die am engsten zusammengehörigen Teile der Aussage zu umschließen, kleine Abweichungen hervorrufen; dieser Grundsatz aber ist darin begriffen, daß, unserm Denkvermögen- entsprechend, von dem unserm Bewußtsein am nächsten Liegenden fortgeschritten wird zu den begrenzenden, einengenden neuen Bestimmungen. Nur deshalb steht im Fragesatze, wenn die Tatsache selber fraglich ist (Satzfrage), das Zeitwort an der Spitze (Hast du das getan?), in Fragen, die nur auf einen Begriff abzielen, dagegen das nur auf diesen abzielende Fragewort (Wortfragen: Was hast du getan?). Eben darum tritt in Wunschsätzen, in denen der Ausdruck des Wunsches allein im Zeitwort liegt, dieses an die Spitze (hättest du doch dies nicht getan!) während in solchen, in denen er durch eine Partikel angedeutet wird, diese vorangeht und dann die gewöhnliche Stellung je nachdem des Haupt- oder Nebensatzes bleibt (Wie wollte sie den zu Tode gehetzten hegen und pflegen! — Wenn du doch dies nicht getan hättest!) Was Wunder also, daß auch im Aussagesatze stets der psychologisch am nächsten liegende Begriff vorangeht? Diese Erkenntnis der einheitlichen Regelung der Wortstellung für alle Sätze läßt zugleich den weiteren Satz hinfällig erscheinen, den die Lehrer „von der Umkehr" an ihren Haupt- und Grundsatz anhängen, daß im Nebensatze das Subjekt der nächste Satzteil hinter dem Bindewort oder dem nicht im Nominativ stehenden Fürworte sei, der ja auch oben durch Beispiele hinreichend widerlegt wird. Überhaupt hebt diese Einsicht die vom Standpunkt der heutigen Sprache ungebührliche Bevorzugung des Subjekts vor den übrigen Satzteilen auf, und indem sie dafür den Begriff des psychologisch nächstliegenden Satzteiles einrückt, gewährt sie die Möglichkeit, über die Stellung aller Satzteile, das Zeitwort, den Satzhalter und -träger ausgenommen, nach einem einzigen unserm Denkvermögen entnommenen Grundsatze zu entscheiden. | |||
Schlimme Folgen der falschen Ansicht von der Stellung des Subjekts. Vielleicht geradezu hervorgerufen durch die Lehre von dem an die Spitze zu stellenden Subjekte sind die zahlreichen Fehler, die darin bestehen, daß das Subjekt in passi $Fußnote auf nächster Seite fortgeführt$ vischen Sätzen in einer das Sprachgefühl verletzenden Weise am Anfange steht. Man höre nur: Als aber die Kugeln von allen Seiten hereinschlugen, als ein Spiegel von einer derselben (statt als von einer ... ein Spiegel) zertrümmert wurde, zog sie sich in den Keller zurück; und den schlimmeren Satz: Auch hier (im Cumaondistrikt) werden Schafe und Ziegen zum Getreidetransport von den Eingeborenen verwendet, wofür am besten stünde: Auch hier werden von den Eingeborenen Schafe und Ziegen zum Getreidetransport verwendet. An dem Verhältnisse des Aktivs zum Passiv, das ja oft nicht wegen einer andern Auffassung sondern lediglich der Deutlichkeit halber gewählt werden muß, wäre es überhaupt besonders leicht gewesen, das Verkehrte jener Lehre einzusehen, wonach das Subjekt soll an der ersten Stelle stehn müssen. Aktivisch sagt jeder; die Eingeborenen verwendeten auch hier oder: Auch hier verwendeten die Eingeborenen Schafe und Ziegen zum Getreidetransport; was in der Welt soll für ein Grund vorhanden sein, passivisch in der oben getadelten Weise umzustellen? — Eine verkehrte Folgerung ist auch die, daß es auf alle Fälle, auch wo der Zusammenhang alles klarstellt, unbequemlich sei und Mißverständnisse hervorrufe, wenn das Objekt dem Subjekte vorangehe und in der Form keines als Subjekt oder Objekt kenntlich sei. Danach getadelt werden wahrhaftig auch Sätze wie die: Eine tote Stille herrschte jetzt in Brüssel, die nur zuweilen das ungewohnte Geräusch der Waffen unterbrach (Schiller), und viele Stellen der Grimmschen Märchen, so: Nun trug sie (Akkusativ) das Männchen wieder in das königliche Schloß und in ihr Bett; deshalb schloß es (Akkusativ) die Zauberin in einen hohen Turm. Da geht aber doch nur wie in Tausenden von Sätzen, die täglich gedruckt, geschrieben und gesprochen werden, der Objektskasus lediglich nach dem — schönen — rhythmischen Gesetze voran, daß ein Satzteil, der nach grammatisch-logischen Forderungen einem anderen nachfolgen müßte, diesem vorantritt, sobald er viel kürzer, unbedeutsamer und weniger betont ist. Wo wirklich — d. h. auch beim Lesen im Zusammenhänge! — durch die aktivische Fügung Undeutlichkeit entsteht, hilft öfter und deutlicher die Verwandlung ins Passiv; daß aber auch, wenn der Rhythmus nicht verletzt wird, die Voranstellung des ersten und die Nachstellung des vierten Falles helfen kann, beruht nicht auf der nach der alten Ansicht bestehenden Notwendigkeit, das Subjekt voranzustellen, sondern auf der sprachgeschichtlich begründeten Gewohnheit, das Objekt nachzustellen, worüber oben mehr!//, sondern muß allgemein heißen: der Satzteil, der psychologisch am nächsten liegt, d.h. $Seite 392$ der nach dem Zusammenhange der Sätze und dem Fortschritte der Darstellung vom Gegebenen, Vorausgehenden oder doch Vorausgesetzten der ist, welcher in unserm Bewußtsein oben aufliegt, weil wir die nächste Aussage als von ihm oder für ihn geltend erwarten. | Psychologisches Grundgesetz der deutschen Wortstellung. Mit Recht kann der Unterschied zwischen den Aussagehauptsätzen einer- und den fragenden und begehrenden andrerseits nur darin gefunden werden, daß in jenen irgend ein Satzteil, in diesen keiner vor dem Zeitwort steht. Nur diese Auffassung kann zu der Einsicht führen, daß sich die Stellung in allen Sätzen — etwas anders sind auf bloße Nomina zusammengezogene, also rein begriffliche Ausdrücke — nach einem einzigen Grundsatze erklärt, soweit nicht Rücksichten auf den Wohllaut oder das Streben, den Satz durch die am engsten zusammengehörigen Teile der Aussage zu umschließen, kleine Abweichungen hervorrufen; dieser Grundsatz aber ist darin begriffen, daß, unserm Denkvermögen- entsprechend, von dem unserm Bewußtsein am nächsten Liegenden fortgeschritten wird zu den begrenzenden, einengenden neuen Bestimmungen. Nur deshalb steht im Fragesatze, wenn die Tatsache selber fraglich ist (Satzfrage), das Zeitwort an der Spitze (''Hast du das getan?''), in Fragen, die nur auf einen Begriff abzielen, dagegen das nur auf diesen abzielende Fragewort (Wortfragen: ''Was hast du getan?''). Eben darum tritt in Wunschsätzen, in denen der Ausdruck des Wunsches allein im Zeitwort liegt, dieses an die Spitze (''hättest du doch dies nicht getan!'') während in solchen, in denen er durch eine Partikel angedeutet wird, diese vorangeht und dann die gewöhnliche Stellung je nachdem des Haupt- oder Nebensatzes bleibt (''Wie wollte sie den zu Tode gehetzten hegen und pflegen! — Wenn du doch dies nicht getan hättest!'') Was Wunder also, daß auch im Aussagesatze stets der psychologisch am nächsten liegende Begriff vorangeht? Diese Erkenntnis der einheitlichen Regelung der Wortstellung für alle Sätze läßt zugleich den weiteren Satz hinfällig erscheinen, den die Lehrer „von der Umkehr" an ihren Haupt- und Grundsatz anhängen, daß im Nebensatze das Subjekt der nächste Satzteil hinter dem Bindewort oder dem nicht im Nominativ stehenden Fürworte sei, der ja auch oben durch Beispiele hinreichend widerlegt wird. Überhaupt hebt diese Einsicht die vom Standpunkt der heutigen Sprache ungebührliche Bevorzugung des Subjekts vor den übrigen Satzteilen auf, und indem sie dafür den Begriff des psychologisch nächstliegenden Satzteiles einrückt, gewährt sie die Möglichkeit, über die Stellung aller Satzteile, das Zeitwort, den Satzhalter und -träger ausgenommen, nach einem einzigen unserm Denkvermögen entnommenen Grundsatze zu entscheiden. | ||
Schlimme Folgen der falschen Ansicht von der Stellung des Subjekts. Vielleicht geradezu hervorgerufen durch die Lehre von dem an die Spitze zu stellenden Subjekte sind die zahlreichen Fehler, die darin bestehen, daß das Subjekt in passi- $Fußnote auf nächster Seite fortgeführt$ vischen Sätzen in einer das Sprachgefühl verletzenden Weise am Anfange steht. Man höre nur: ''Als aber die Kugeln von allen Seiten hereinschlugen, als ein Spiegel von einer derselben'' (statt ''als von einer ... ein Spiegel'') zertrümmert wurde, zog sie sich in den Keller zurück; und den schlimmeren Satz: ''Auch hier'' (''im Cumaondistrikt'') ''werden Schafe und Ziegen zum Getreidetransport von den Eingeborenen verwendet'', wofür am besten stünde: ''Auch hier werden von den Eingeborenen Schafe und Ziegen zum Getreidetransport verwendet''. An dem Verhältnisse des Aktivs zum Passiv, das ja oft nicht wegen einer andern Auffassung sondern lediglich der Deutlichkeit halber gewählt werden muß, wäre es überhaupt besonders leicht gewesen, das Verkehrte jener Lehre einzusehen, wonach das Subjekt soll an der ersten Stelle stehn müssen. Aktivisch sagt jeder; ''die Eingeborenen verwendeten auch hier'' oder: ''Auch hier verwendeten die Eingeborenen Schafe und Ziegen zum Getreidetransport''; was in der Welt soll für ein Grund vorhanden sein, passivisch in der oben getadelten Weise umzustellen? — Eine verkehrte Folgerung ist auch die, daß es auf alle Fälle, auch wo der Zusammenhang alles klarstellt, unbequemlich sei und Mißverständnisse hervorrufe, wenn das Objekt dem Subjekte vorangehe und in der Form keines als Subjekt oder Objekt kenntlich sei. Danach getadelt werden wahrhaftig auch Sätze wie die: ''Eine tote Stille herrschte jetzt in Brüssel, die nur zuweilen das ungewohnte Geräusch der Waffen unterbrach'' (Schiller), und viele Stellen der Grimmschen Märchen, so: ''Nun trug sie'' (Akkusativ) ''das Männchen wieder in das königliche Schloß und in ihr Bett; deshalb schloß es'' (Akkusativ) ''die Zauberin in einen hohen Turm''. Da geht aber doch nur wie in Tausenden von Sätzen, die täglich gedruckt, geschrieben und gesprochen werden, der Objektskasus lediglich nach dem — schönen — rhythmischen Gesetze voran, daß ein Satzteil, der nach grammatisch-logischen Forderungen einem anderen nachfolgen müßte, diesem vorantritt, sobald er viel kürzer, unbedeutsamer und weniger betont ist. Wo wirklich — d. h. auch beim Lesen im Zusammenhänge! — durch die aktivische Fügung Undeutlichkeit entsteht, hilft öfter und deutlicher die Verwandlung ins Passiv; daß aber auch, wenn der Rhythmus nicht verletzt wird, die Voranstellung des ersten und die Nachstellung des vierten Falles helfen kann, beruht nicht auf der nach der alten Ansicht bestehenden Notwendigkeit, das Subjekt voranzustellen, sondern auf der sprachgeschichtlich begründeten Gewohnheit, das Objekt nachzustellen, worüber oben mehr!//, sondern muß allgemein heißen: der Satzteil, der psychologisch am nächsten liegt, d.h. $Seite 392$ der nach dem Zusammenhange der Sätze und dem Fortschritte der Darstellung vom Gegebenen, Vorausgehenden oder doch Vorausgesetzten der ist, welcher in unserm Bewußtsein oben aufliegt, weil wir die nächste Aussage als von ihm oder für ihn geltend erwarten. | |||
Was das bedeutet, mögen einige Mustersätze zeigen. ''Einen Abend'' — das gibt den zeitlichen Rahmen für das ganze Folgende an, ohne betont zu sein — ''stritt die Gesellschaft, ob der Roman oder das Drama den Vorzug verdiene .... Endlich war folgendes ohngefähr das Resultat ihrer Unterhaltung. Im Roman wie im Drama'' — diese Gegenstände der Unterhaltung sind bekannt, nicht aber betont — ''sehen wir menschliche Natur und Handlung .... Im Roman'' (gegeben und betont) ''sollen vorzüglich Gesinnungen und Begebenheiten vorgestellt werden, im Drama Charakter und Taten. Der Romanheld muß leidend ... sein, von dem dramatischen verlangt man Wirkung und Tat. So vereinigte man sich auch darüber'' usw. (Goethe). — ''Ich war nun einmal in einen Kreis hineingesperrt. Gewisse Verbindungen'' (''eine Ausführung jenes Kreises'') ''konnte ich nicht so los werden, und in der mir so angelegenen Sache'' — ist schon genannt — ''drängten und häuften sich die Fatalitäten''. | Was das bedeutet, mögen einige Mustersätze zeigen. ''Einen Abend'' — das gibt den zeitlichen Rahmen für das ganze Folgende an, ohne betont zu sein — ''stritt die Gesellschaft, ob der Roman oder das Drama den Vorzug verdiene .... Endlich war folgendes ohngefähr das Resultat ihrer Unterhaltung. Im Roman wie im Drama'' — diese Gegenstände der Unterhaltung sind bekannt, nicht aber betont — ''sehen wir menschliche Natur und Handlung .... Im Roman'' (gegeben und betont) ''sollen vorzüglich Gesinnungen und Begebenheiten vorgestellt werden, im Drama Charakter und Taten. Der Romanheld muß leidend ... sein, von dem dramatischen verlangt man Wirkung und Tat. So vereinigte man sich auch darüber'' usw. (Goethe). — ''Ich war nun einmal in einen Kreis hineingesperrt. Gewisse Verbindungen'' (''eine Ausführung jenes Kreises'') ''konnte ich nicht so los werden, und in der mir so angelegenen Sache'' — ist schon genannt — ''drängten und häuften sich die Fatalitäten''. | ||
Version vom 23. Januar 2017, 13:45 Uhr
Hinweis: Dieses Kapitel ist derzeit noch in Bearbeitung. Die angezeigten Informationen könnten daher fehlerhaft oder unvollständig sein.
| Buch | Matthias (1929): Sprachleben und Sprachschäden. Ein Führer durch die Schwankungen und Schwierigkeiten des deutschen Sprachgebrauchs. |
|---|---|
| Seitenzahlen | 391 - 393 |
Nur für eingeloggte User:
| Unsicherheit |
|---|
In diesem Kapitel behandelte Zweifelsfälle
| Behandelter Zweifelfall: | |
|---|---|
| Genannte Bezugsinstanzen: | Sprachgelehrsamkeit, Goethe - Johann Wolfgang |
| Text |
|---|
|
Genauer: wie verhält es sich mit dem ersten Gliede des Hauptsatzes und dem, das im Nebensatze auf das Bindewort, folgt oder auf sein einleitendes Fürwort, falls dies kein Nominativ ist? Die richtige Antwort darf freilich nicht lauten wie bei den meisten Grammatikern: das Subjekt//1 Vgl. vor allen Erdmann (S. 183) und Poeschel an dem § 205 a. O. (S. 233). Ebenso gut wie der Subjektsnominativ kann jeher oblique Kasus, jede adverbiale oder prädikative Bestimmung vorantreten, wenigstens auf der Höhe der entwickelten Sprache, und zwar sowohl nachdrücklich betonte als auch ganz unwichtige, sowohl kurze als sehr umfangreiche Bestimmungen (nur nicht mehr das Reflexiv). Erklärlich ist der Irrtum der meisten Grammatiker immerhin, da tatsächlich das Subjekt am häufigsten an der ersten Stelle des Haupt- und der zweiten des Nebensatzes steht. Sie haben nur den Grund davon verkannt, daß dieses nämlich öfter als ein anderer Satzteil das Satzglied ist, welches psychologisch am nächsten liegt, von dem die neue Satzbildung ausgeht, für das sie gilt. Andrerseits hätte der Irrtum an dem Widerspruche erkannt werden müssen, daß die nämlichen Grammatiker ein und dieselbe Stellung: Prädikat + Subjekt, die sie als bezeichnend für den selbständigen Frage- und Wunschsatz hinstellen, auch für jeden Aussagehauptsatz zugeben müssen, wenn auch als sogenannte Umkehr (inversio), sobald er einen anderen Satzteil als das Subjekt an der Spitze hat; und dabei läßt sich dieses Eindringen des für ganz andere Satzarten charakteristischen Aufbaues auch in die Aussagesätze nicht im geringsten dadurch erklären, daß in diesen dann immer ein unsichrer Frage- oder lebhafter Wunschton anklänge. Psychologisches Grundgesetz der deutschen Wortstellung. Mit Recht kann der Unterschied zwischen den Aussagehauptsätzen einer- und den fragenden und begehrenden andrerseits nur darin gefunden werden, daß in jenen irgend ein Satzteil, in diesen keiner vor dem Zeitwort steht. Nur diese Auffassung kann zu der Einsicht führen, daß sich die Stellung in allen Sätzen — etwas anders sind auf bloße Nomina zusammengezogene, also rein begriffliche Ausdrücke — nach einem einzigen Grundsatze erklärt, soweit nicht Rücksichten auf den Wohllaut oder das Streben, den Satz durch die am engsten zusammengehörigen Teile der Aussage zu umschließen, kleine Abweichungen hervorrufen; dieser Grundsatz aber ist darin begriffen, daß, unserm Denkvermögen- entsprechend, von dem unserm Bewußtsein am nächsten Liegenden fortgeschritten wird zu den begrenzenden, einengenden neuen Bestimmungen. Nur deshalb steht im Fragesatze, wenn die Tatsache selber fraglich ist (Satzfrage), das Zeitwort an der Spitze (Hast du das getan?), in Fragen, die nur auf einen Begriff abzielen, dagegen das nur auf diesen abzielende Fragewort (Wortfragen: Was hast du getan?). Eben darum tritt in Wunschsätzen, in denen der Ausdruck des Wunsches allein im Zeitwort liegt, dieses an die Spitze (hättest du doch dies nicht getan!) während in solchen, in denen er durch eine Partikel angedeutet wird, diese vorangeht und dann die gewöhnliche Stellung je nachdem des Haupt- oder Nebensatzes bleibt (Wie wollte sie den zu Tode gehetzten hegen und pflegen! — Wenn du doch dies nicht getan hättest!) Was Wunder also, daß auch im Aussagesatze stets der psychologisch am nächsten liegende Begriff vorangeht? Diese Erkenntnis der einheitlichen Regelung der Wortstellung für alle Sätze läßt zugleich den weiteren Satz hinfällig erscheinen, den die Lehrer „von der Umkehr" an ihren Haupt- und Grundsatz anhängen, daß im Nebensatze das Subjekt der nächste Satzteil hinter dem Bindewort oder dem nicht im Nominativ stehenden Fürworte sei, der ja auch oben durch Beispiele hinreichend widerlegt wird. Überhaupt hebt diese Einsicht die vom Standpunkt der heutigen Sprache ungebührliche Bevorzugung des Subjekts vor den übrigen Satzteilen auf, und indem sie dafür den Begriff des psychologisch nächstliegenden Satzteiles einrückt, gewährt sie die Möglichkeit, über die Stellung aller Satzteile, das Zeitwort, den Satzhalter und -träger ausgenommen, nach einem einzigen unserm Denkvermögen entnommenen Grundsatze zu entscheiden. Schlimme Folgen der falschen Ansicht von der Stellung des Subjekts. Vielleicht geradezu hervorgerufen durch die Lehre von dem an die Spitze zu stellenden Subjekte sind die zahlreichen Fehler, die darin bestehen, daß das Subjekt in passi- $Fußnote auf nächster Seite fortgeführt$ vischen Sätzen in einer das Sprachgefühl verletzenden Weise am Anfange steht. Man höre nur: Als aber die Kugeln von allen Seiten hereinschlugen, als ein Spiegel von einer derselben (statt als von einer ... ein Spiegel) zertrümmert wurde, zog sie sich in den Keller zurück; und den schlimmeren Satz: Auch hier (im Cumaondistrikt) werden Schafe und Ziegen zum Getreidetransport von den Eingeborenen verwendet, wofür am besten stünde: Auch hier werden von den Eingeborenen Schafe und Ziegen zum Getreidetransport verwendet. An dem Verhältnisse des Aktivs zum Passiv, das ja oft nicht wegen einer andern Auffassung sondern lediglich der Deutlichkeit halber gewählt werden muß, wäre es überhaupt besonders leicht gewesen, das Verkehrte jener Lehre einzusehen, wonach das Subjekt soll an der ersten Stelle stehn müssen. Aktivisch sagt jeder; die Eingeborenen verwendeten auch hier oder: Auch hier verwendeten die Eingeborenen Schafe und Ziegen zum Getreidetransport; was in der Welt soll für ein Grund vorhanden sein, passivisch in der oben getadelten Weise umzustellen? — Eine verkehrte Folgerung ist auch die, daß es auf alle Fälle, auch wo der Zusammenhang alles klarstellt, unbequemlich sei und Mißverständnisse hervorrufe, wenn das Objekt dem Subjekte vorangehe und in der Form keines als Subjekt oder Objekt kenntlich sei. Danach getadelt werden wahrhaftig auch Sätze wie die: Eine tote Stille herrschte jetzt in Brüssel, die nur zuweilen das ungewohnte Geräusch der Waffen unterbrach (Schiller), und viele Stellen der Grimmschen Märchen, so: Nun trug sie (Akkusativ) das Männchen wieder in das königliche Schloß und in ihr Bett; deshalb schloß es (Akkusativ) die Zauberin in einen hohen Turm. Da geht aber doch nur wie in Tausenden von Sätzen, die täglich gedruckt, geschrieben und gesprochen werden, der Objektskasus lediglich nach dem — schönen — rhythmischen Gesetze voran, daß ein Satzteil, der nach grammatisch-logischen Forderungen einem anderen nachfolgen müßte, diesem vorantritt, sobald er viel kürzer, unbedeutsamer und weniger betont ist. Wo wirklich — d. h. auch beim Lesen im Zusammenhänge! — durch die aktivische Fügung Undeutlichkeit entsteht, hilft öfter und deutlicher die Verwandlung ins Passiv; daß aber auch, wenn der Rhythmus nicht verletzt wird, die Voranstellung des ersten und die Nachstellung des vierten Falles helfen kann, beruht nicht auf der nach der alten Ansicht bestehenden Notwendigkeit, das Subjekt voranzustellen, sondern auf der sprachgeschichtlich begründeten Gewohnheit, das Objekt nachzustellen, worüber oben mehr!//, sondern muß allgemein heißen: der Satzteil, der psychologisch am nächsten liegt, d.h. $Seite 392$ der nach dem Zusammenhange der Sätze und dem Fortschritte der Darstellung vom Gegebenen, Vorausgehenden oder doch Vorausgesetzten der ist, welcher in unserm Bewußtsein oben aufliegt, weil wir die nächste Aussage als von ihm oder für ihn geltend erwarten. Was das bedeutet, mögen einige Mustersätze zeigen. Einen Abend — das gibt den zeitlichen Rahmen für das ganze Folgende an, ohne betont zu sein — stritt die Gesellschaft, ob der Roman oder das Drama den Vorzug verdiene .... Endlich war folgendes ohngefähr das Resultat ihrer Unterhaltung. Im Roman wie im Drama — diese Gegenstände der Unterhaltung sind bekannt, nicht aber betont — sehen wir menschliche Natur und Handlung .... Im Roman (gegeben und betont) sollen vorzüglich Gesinnungen und Begebenheiten vorgestellt werden, im Drama Charakter und Taten. Der Romanheld muß leidend ... sein, von dem dramatischen verlangt man Wirkung und Tat. So vereinigte man sich auch darüber usw. (Goethe). — Ich war nun einmal in einen Kreis hineingesperrt. Gewisse Verbindungen (eine Ausführung jenes Kreises) konnte ich nicht so los werden, und in der mir so angelegenen Sache — ist schon genannt — drängten und häuften sich die Fatalitäten. Auch im Nebensatze ist es durchaus die Regel, daß der Satzteil, der psychologisch näher liegt als das Subjekt, unmittelbar auf die Einleitung folgt, so namentlich oblique Fälle von Fürwörtern, die sich ja schon durch ihre Beziehung als dieser näher liegende Satzteil darstellen. Man ver- $Seite 393$ gleiche wieder Goethe: Sie setzte ihre Freigebigkeit gegen die Armen auf dem Heimwege fort, indem sie zuletzt, als ihr und ihren Reisegefährten (sind schon genannt) das Geld ausging (das stellte sich erst heraus), einem Mädchen ihren Strohhut ... hinauswarf. — Nun sollte Leseprobe gehalten werden, Wilhelm hatte die Rollen vorher kollationiert, so daß von dieser Seite (was das schon erwähnte kollationieren anlangt) kein Anstoß sein konnte ... Serlo versicherte, daß er jeder andern Probe ... nachsehn wolle, sobald der Leseprobe (schon vorher gegeben) ihr Recht widerfahren seiv. Dazu zwei etwas anders geartete Beispiele: Er erlaubte durchaus keine Freiheit, als die allenfalls die ganze Welt hätte wissen dürfen. — Da nun auch unglücklicherweise Regentage einfielen ..., so dankte er dem Himmel, als er sich dem flachen Lande wieder näherte. Man stelle nur um: die die Welt allenfalls hätte wissen dürfen, und: als Regentage unglücklicherweise einfielen, so ist jeder versucht zu fragen: „allenfalls wissen, aber nicht ahnen?" „Konnten die Regentage auch glücklicherweise einfallen?" Die Nachstellung würde zu einem Urteile nur über die Art des Kennenlernens und Einfallens führen, während die Voranstellung dieser Adverbien für die ganze Aussage, das Subjekt eingeschlossen, die richtige Auffassung gebietet. Daher kommt es ebensowohl, daß solche urteilende Adverbien (§ 45), als auch, daß Orts- und Zeitbestimmungen, die den Rahmen für das Ganze abgeben, gern vorangehn, letztere namentlich in Hauptsätzen. |
| Zweifelsfall | |
|---|---|
| Beispiel | |
| Bezugsinstanz | Goethe - Johann Wolfgang, Sprachgelehrsamkeit |
| Bewertung | |
| Intertextueller Bezug |