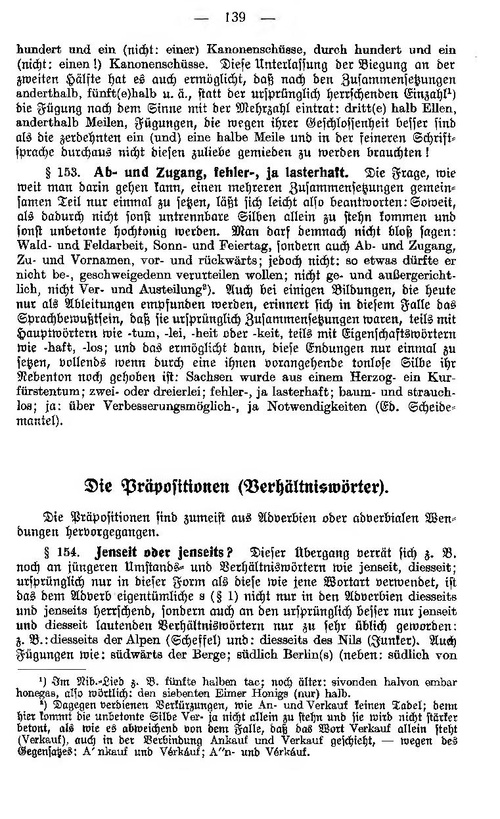Jenseit oder jenseits?
| Buch | Matthias (1929): Sprachleben und Sprachschäden. Ein Führer durch die Schwankungen und Schwierigkeiten des deutschen Sprachgebrauchs. |
|---|---|
| Seitenzahlen | 139 - 140 |
Nur für eingeloggte User:
| Unsicherheit |
|---|
In diesem Kapitel behandelte Zweifelsfälle
| Behandelter Zweifelfall: |
Präpositional gebrauchte Substantive, Adverbien und Adjektive |
|---|---|
| Genannte Bezugsinstanzen: | Junker - Wilhelm, Ursprünglich, Neu, Scheffel - Joseph Victor von |
| Text |
|---|
|
Dieser Übergang verrät sich z. B. noch an jüngeren Umstands- und Verhältniswörtern wie jenseit, diesseit; ursprünglich nur in dieser Form als diese wie jene Wortart verwendet, ist das dem Adverb eigentümliche s (§ 1) nicht nur in den Adverbien diesseits und jenseits herrschend, sondern auch an den ursprünglich besser nur jenseit und diesseit lautenden Verhältniswörtern nur zu sehr üblich geworden: z. B.: diesseits der Alpen (Scheffel) und: diesseits des Nils (Junker). Auch Fügungen wie: südwärts der Berge; südlich Berlin(s) (neben: südlich von $Seite 140$ Berlin), nördlich des Rheins sind zwar jüngere, aber nicht anzufechtende Beispiele solches Übergangs. |
| Zweifelsfall |
Präpositional gebrauchte Substantive, Adverbien und Adjektive |
|---|---|
| Beispiel |
jenseit, diesseit, diesseits, jenseits, jenseit, diesseit |
| Bezugsinstanz | neu, Junker - Wilhelm, Scheffel - Joseph Victor von, ursprünglich |
| Bewertung |
besser, besser, Frequenz/herrschend, Frequenz/herrschend, Frequenz/nur, Frequenz/nur, Frequenz/nur zu sehr üblich, Frequenz/nur zu sehr üblich |
| Intertextueller Bezug |