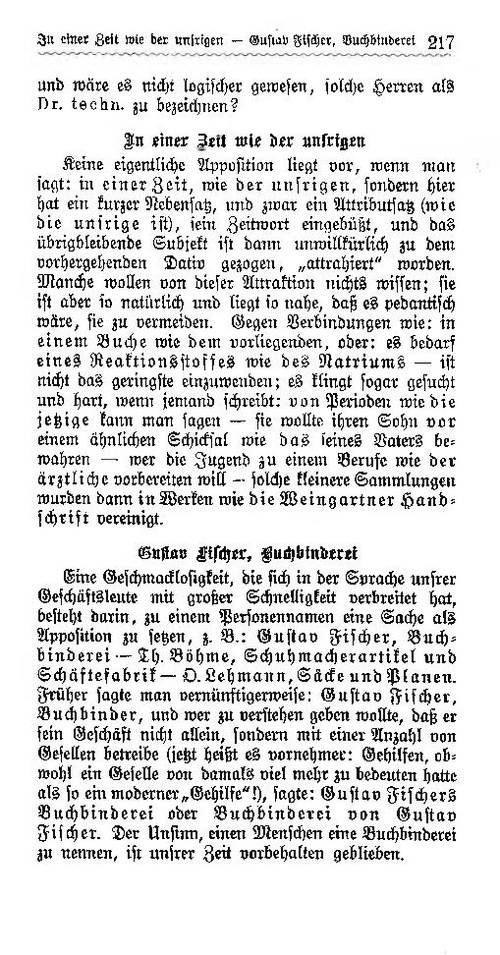Wustmann(1903) Gustav Fischer Buchbinderei: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
K Sstark verschob die Seite Wustmann(1903) Gustav Fischer, Buchbinderei nach Wustmann(1903) Gustav Fischer Buchbinderei, ohne dabei eine Weiterleitung anzulegen |
(kein Unterschied)
| |
Version vom 15. September 2016, 19:50 Uhr
Hinweis: Dieses Kapitel ist derzeit noch in Bearbeitung. Die angezeigten Informationen könnten daher fehlerhaft oder unvollständig sein.
| Buch | Wustmann (1903): Allerhand Sprachdummheiten. Kleine deutsche Grammatik des Zweifelhaften, des Falschen und des Häßlichen |
|---|---|
| Seitenzahlen | 217 - 218 |
Nur für eingeloggte User:
| Unsicherheit |
|---|
In diesem Kapitel behandelte Zweifelsfälle
| Behandelter Zweifelfall: | |
|---|---|
| Genannte Bezugsinstanzen: | Gegenwärtig, Alt, Neu, Schriftsprache, Zeitungssprache, Geschäftssprache |
| Text |
|---|
|
Eine Geschmacklosigkeit, die sich in der Sprache unsrer Geschäftsleute mit großer Schnelligkeit verbreitet hat, besteht darin, zu einem Personennamen eine Sache als Apposition zu setzen, z. B.: Gustav Fischer, Buch- binderei — Th. Böhme, Schuhmacherartikel und Schäftefabrik— O. Lehmann, Säcke und Planen. Früher sagte man vernünftigerweise: Gustav Fischer, Buchbinder, und wer zu verstehen geben wollte, daß er sein Geschäft nicht allein, sondern mit einer Anzahl von Gesellen betreibe (jetzt heißt es vornehmer: Gehilfen, ob- wohl ein Geselle von damals viel mehr zu bedeuten hatte als so ein moderner „Gehilfe"!), sagte: Gustav Fischers Buchbinderei oder Buchbinderei von Gustav Fischer. Der Unsinn, einen Menschen eine Buchbinderei zu nennen, ist unsrer Zeit vorbehalten geblieben. $Seite 218$ Man könnte einwenden, in solchen Verbindungen solle der Personenname gar nicht den Mann bedeuten, sondern die Firma, das Geschäft; in dem Zusatz solle also gar keine Apposition liegen, sondern mehr eine „Juxtaposition." In den altmodischen Firmen sei nur der eine Satz ausgedrückt gewesen: (hier wohnt) Gustav Fischer; in den neumodischen Firmen seien zwei Sätze ausgedrückt: (hier wohnt) Karl Bellach, (der hat eine) photographische Anstalt, oder: (hier hat sein Geschäft) Siegfried Cohn, (der verkauft) Wolle. Wie steht es denn aber dann, wenn man in einem Ausstellerverzeichnis lesen muß: Herr F. A. Barthel, Abteilung für Metallklammern, oder in einer Verlobungsanzeige: Herr Max Schnetger, Rosenzüchterei, mit Fräulein Luise Langbein, oder in einem Fremdenbuche: Rudolf Dahme, Kognakbrennerei, mit Gattin und Tochter, oder in einer Zeitung: Herr Gustav Böhme jun., Bureau für Orientreisen, telegraphiert uns usw.? Ist da auch die Firma gemeint? Zum Teil ist dieser Unsinn eine Folge der Prahlsucht*) unsrer Geschäftsleute; es will niemand mehr Gärtner oder Brauer, Tischler oder Buchbinder sein, sondern nur noch Gärtnereibesitzer, Brauereibesitzer, Tischlereibesitzer, Buchbindereibesitzer — immer großartig! Da darf natürlich die Buchbinderei auch in der Firma nicht fehlen. Zum andern Teil ist er aber doch auch eine Folge der Verwilderung unsers Sprach- gefühls. W. Spindlers Waschanstalt und Gotthelf Kühnes Weinkellereien — das wäre Sprache; W. Spindler Färberei und Waschanstalt und Gotthelf Kühne Weinkellereien — das ist Ge- stammel. Man will aber gar nicht mehr sprechen, man will eben stammeln. |
| Zweifelsfall | |
|---|---|
| Beispiel | |
| Bezugsinstanz | alt, Geschäftssprache, Schriftsprache, alt, Geschäftssprache, gegenwärtig, neu, neu, gegenwärtig, Zeitungssprache, Zeitungssprache |
| Bewertung |
das wäre Sprache, Folge der Prahlsucht, Folge der Verwilderung unsers Sprachgefühls, Geschmacklosigkeit, Gestammel, Unsinn, vernünftigerweise, vornehmer |
| Intertextueller Bezug |