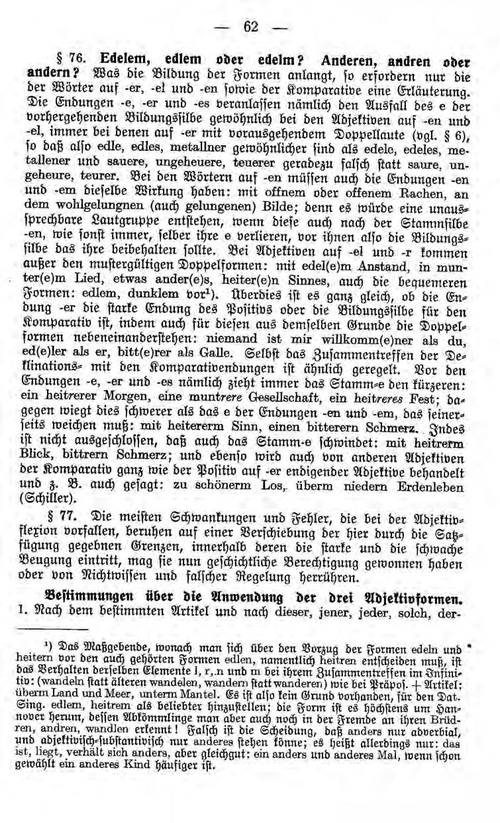Edelem, edlem oder edelm? Anderen, andren oder andern?
Hinweis: Dieses Kapitel ist derzeit noch in Bearbeitung. Die angezeigten Informationen könnten daher fehlerhaft oder unvollständig sein.
| Buch | Matthias (1929): Sprachleben und Sprachschäden. Ein Führer durch die Schwankungen und Schwierigkeiten des deutschen Sprachgebrauchs. |
|---|---|
| Seitenzahlen | 62 - 62 |
Nur für eingeloggte User:
| Unsicherheit |
|---|
In diesem Kapitel behandelte Zweifelsfälle
| Behandelter Zweifelfall: | |
|---|---|
| Genannte Bezugsinstanzen: | Schiller - Friedrich |
| Text |
|---|
|
§ 76. Edelem, edlem oder edelm? Anderen, andren oder andern? Was die Bildung der Formen anlangt, so erfordern nur die der Wörter auf -er, -el und -en sowie der Komparative eine Erläuterung. Die Endungen -e, -er und -es veranlassen nämlich den Ausfall des e der vorhergehenden Bildungssilbe gewöhnlich bei den Adjektiven auf -en und -el, immer bei denen auf -er mit vorausgehendem Doppellaute (vgl. § 6), so daß also edle, edles, metallner gewöhnlicher sind als edele, edeles, me-tallener und sauere, ungeheuere, teuerer geradezu falsch statt saure, un-geheure, teurer. Bei den Wörtern auf -en müssen auch die Endungen -en und -em dieselbe Wirkung haben: mit offnem oder offenem Rachen, an dem wohlgelungnen (auch gelungenen) Bilde; denn es würde eine unaus-sprechbare Lautgruppe entstehen, wenn diese auch nach der Stammsilbe -en, wie sonst immer, selber ihre e verlieren, vor ihnen also die Bildungs-silbe das ihre beibehalten sollte. Bei Adjektiven auf -el und -r kommen außer den mustergültigen Doppelformen: mit edel(e)m Anstand, in mun-ter(e)m Lied, etwas ander(e)s, heiter(e)n Sinnes, auch die bequemeren Formen: edlem, dunklem vor //* Das Maßgebende, wonach man sich über den Vorzug der Formen edeln und heitern vor den auch gehörten Formen edlen, namentlich heitren entscheiden muß, ist das Verhalten derselben Elemente 1, r, n und m bei ihrem Zusammentreffen im Infini-tiv: (wandeln statt älteren wandelen, wandern statt wanderen) wie bei Präpos. + Artikel: überm Land und Meer, unterm Mantel. Es ist also kein Grund vorhanden, für den Dat. Sing. edlem, heitrem als beliebter hinzustellen; die Form ist es höchstens um Han-nover herum, dessen Abkömmlinge man aber auch noch in der Fremde an ihren Brüd-ren, andren, wandlen erkennt! Falsch ist die Scheidung, daß anders nur adverbial, und adjektivisch-substantivisch nur anderes stehen könne; es heißt allerdings nur: das ist, liegt, verhält sich anders, aber gleichgut: ein anders und anderes Mal, wenn schon gewählt ein anderes Kind häufiger ist.//. Überdies ist es ganz gleich, ob die En-dung -er die starke Endung des Positivs oder die Bildungssilbe für den Komparativ ist, indem auch für diesen aus demselben Grunde die Doppel-formen nebeneinanderstehen: niemand ist mir willkomm(e)ner als du, ed(e)ler als er, bitt(e)rer als Galle. Selbst das Zusammentreffen der De-klinations- mit den Komparativendungen ist ähnlich geregelt. Vor den Endungen -e, -er und -es nämlich zieht immer das Stamm-e den kürzeren: ein heitrerer Morgen, eine muntrere Gesellschaft, ein heitreres Fest; da-gegen wiegt dies schwerer als das e der Endungen -en und -em, das seiner-seits weichen muß: mit heitererm Sinn, einen bitterern Schmerz. Indes ist nicht ausgeschlossen, daß auch das Stamm-e schwindet: mit heitrerm Blick, bittrern Schmerz; und ebenso wird auch von anderen Adjektiven der Komparativ ganz wie der Positiv auf -er endigender Adjektive behandelt und z. B. auch gesagt: zu schönerm Los, überm niedern Erdenleben (Schiller). |
| Zweifelsfall | |
|---|---|
| Beispiel |
edle, edles, edele, edeles, metallner, metallener, sauere, saure, ungeheuere, teuerer, ungeheure, teurer, offnem, offenem, wohlgelungnen, gelungenen, edelem, edelm, munterm, munterem, anders, anderes, heitern, heiteren, edlem, dunklem, willkommener, willkommner, edler, edeler, bittrer, bitterer, heitrerer, muntrere, heitreres, heitererm, bitterern, heitrerm, schönerm, niedern |
| Bezugsinstanz | Schiller - Friedrich |
| Bewertung |
bequemer, Frequenz/gewöhnlich, Frequenz/immer, ganz gleich, geradezu falsch, mustergültig, unaussprechbar |
| Intertextueller Bezug |